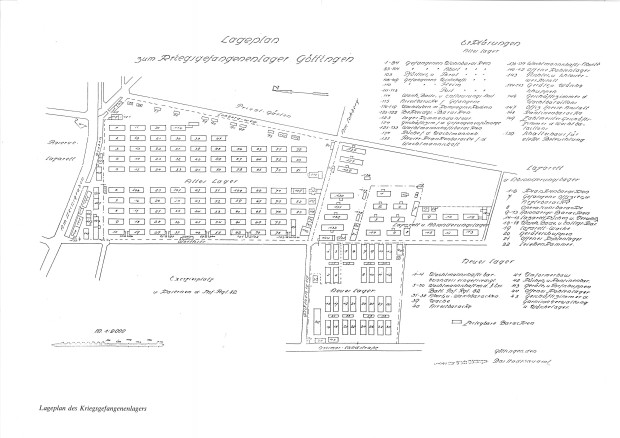Zwischen Aufklärung und Arbeitserziehung
von Larissa Klick
Heute wirkt das Gebäude „Untere-Masch-Straße 3“ am Westrand der Göttinger Innenstadt recht unscheinbar, wie eine der vielen als Wohnhaus genutzten Altbauten. Jedoch beherbergte es noch bis weit in die Weimarer Republik hinein eine Besonderheit, die die Göttinger Universität von anderen unterscheidet: Ein Waisenhaus, welches bis zu seiner Schließung der Theologischen Fakultät unterstellt war. Wie es zur Errichtung eines solch speziellen Hauses kam, inwiefern es sich von anderen Einrichtungen unterschied und wer die Kinder waren, die im Göttinger Universitätswaisenhaus aufwuchsen, soll im Folgenden erläutert werden.
Von der Armenschule zum Waisenhaus
Schon 1737, im Gründungsjahr der Universität, war in Göttingen eine Armenschule von dem begüterten Studenten Reichsgraf Heinrich XI. Reuß gestiftet worden. Die hannoversche, königliche Regierung übertrug daraufhin der theologischen Fakultät die Aufsicht der Schule und gab den Auftrag, die Kinder mit Hilfe „heilsamen Unterrichts“ (zit. nach Meumann 1997, S. 25/26) zu erziehen. Die Stiftung des Grafen geschah möglicherweise auf Betreiben seines pietistisch geprägten Erziehers Mühlenberg (Meumann 1997, S. 28-31). Die pietistische Erziehung von Armen war ein zentrales Projekt des in Halle tätigen August Herrmann Franckes (1663-1727), dessen Predigten zum Thema Nächstenliebe Anfang des 18. Jahrhunderts viel Beachtung geschenkt wurden. Franckes Konzept beeinflusste die Erziehung in der Armenfürsorge in anderen Städten. Ein erklärtes Ziel war es, Kinder aus verarmten Familien so früh wie möglich durch Disziplin zu einer Gemeinschaft mit Gott und anderen Christen bzw. weg von der Verwahrlosung zu führen (Kuhn 2003, S. 43-45).
Ein an die Armenschule gebundenes Haus für Waisen gab es seit 1743. Dort wurden sechs bis acht Jungen von einer Waisenmutter betreut und umsorgt. Der Bedarf war jedoch größer und nach einer weiteren Stiftung, diesmal von einem Adligen aus dem nahegelegenen Einbeck und einer weiteren königlichen Genehmigung, wurde ein großes Grundstück gekauft. Das Gebäude in der Unteren-Masch-Straße war 1750 bezugsfertig und schon 1751 lebten 22 Kinder in dem neuerrichteten Waisenhaus. Der Bau wurde finanziell durch private Großspenden von Göttingern und von auswärts, aber auch durch Kleinspenden, Sachspenden und unentgeltliche Leistungen von Bürgern unterstützt (Meumann 1997, S. 42-45). In den folgenden Jahren wurde so gewirtschaftet, dass das Waisenhaus fast autark haushielt. Die recht begüterte Institution blieb bis ins 20. Jahrhundert finanziell unabhängig und wurde durch regelmäßige Spenden unterstützt. Die theologische Fakultät war zwar Träger des Waisenhauses, jedoch hielt sich ihr Einfluss und finanzielle Unterstüztung in Grenzen (Meumann 1997, S. 48).
Die Kinder des Waisenhauses
Schon vor der Errichtung waren die Rechte des Waisenhauses daran gekoppelt, dass man Bürgerkinder bei der Aufnahme bevorzugte. Das hatten die Räte der Stadt nach Verhandlungen mit der Fakultät, den Bürgervorstehern und Gildemeister als Bedingung für die Unterstützung des Hauses festlegt (Meumann 1997, S. 44). Die Versorgung und standesgerechte Erziehung jener war demnach auch das Ziel der Einrichtung. Jedoch entstand dadurch ein Konflikt, der in den nächsten Abschnitten noch erläutert wird.
Trotz weniger Zeugnisse über die Herkunft der Waisenkinder, ist bekannt, dass vielfach Kinder von Göttinger Witwen aufgenommen wurden. Der Vater entstammte oft einer Handwerkerfamilie, somit ursprünglich aus (klein-)bürgerlichen Verhältnissen, hatte jedoch dann in verarmten Verhältnissen gelebt. Kein Elternteil, falls einer noch lebte, und auch keine andere verwandte Person waren im Stande, die Kinder zu versorgen. Aufgenommen wurden ehelich gezeugte, bis 1840 ausschließlich evangelische Kinder aus Göttingen ab einem Alter von 6 Jahren, da die Säuglings- und Kleinkinderpflege zu kosten- und zeitintensiv war. Die Entlassung aus der Institution sollte nach der Konfirmation, später erst nach dem ersten Lehrjahr erfolgen (Meumann 1997, S. 75-77, 81). Die Zahl der bedürftigen Kinder ist viel höher einzuschätzen, als die die tatsächlich im Waisenhaus unterkamen, da die Aufnahmekriterien wie beschrieben streng waren.
Die Kinder zur Arbeit erziehen
In der Ständegesellschaft des 18. und auch noch des 19. Jahrhunderts waren die im Waisenhaus lebenden Kinder dazu bestimmt, später in den Stand ihrer zu meist verarmten Eltern zurückzukehren. Die Jungen sollten somit wieder Handwerkergesellen werden und die Mädchen später bis zu ihrer Hochzeit als Magd oder in der ansässigen Textilverarbeitung als Spinnerinnen arbeiten. Der Heimalltag bereitete sie insofern auf dieses Leben vor, als ein Pfeiler in der Heimerziehung des 18. Jahrhunderts die Erziehung zur Arbeit war. Die Waisenkinder hatten in ihrem Tagesablauf feste Arbeitsstunden integriert, in denen sie Aufgaben im Haus und in der heimeigenen Spinnerei wahrnahmen. Sie sollten dadurch an Arbeit gewöhnt werden, etwas zu ihrem eigenen Unterhalt beitragen, aber auch auf diese Weise Gott dienen. Zu letzterem ist zu sagen, dass die Heranführung an ein religiöses Leben für die Erziehung besonders auch für die Heimerziehung dieser Zeit eine zentrale Rolle hatte. So wurden während der nachmittäglichen Arbeit auch Texte aus Sittenbüchern vorgelesen und besprochen (Meumann 1997, S. 62-64).
Die Waisenkinder zu kleinen Denkern machen?

Deckbalt der “neun und zwanzigsten Nachrichten von dem göttingischen Waisenhause”, 1777, s. Link unten
Eine schulische Erziehung als Vorbereitung auf das zukünftige Leben der Heimkinder schien aus den oben beschriebenen Erwartungen sinnvoll, musste aber nicht über eine primäre Bildung im Bereich des Schreibens, Lesens, Rechnens und etwas religiöser Schulung hinausgehen. Dennoch entstand ein Konflikt, wie die Bildung der Waisenkinder aussehen sollte. Einerseits definierte der Dekan der theologischen Fakultät Miller 1777 als Ziel, die Waisen zu „guten und glücklichen Mitgliedern der bürgerlichen Gesellschaft“ (Nachricht von dem Göttingischen Waisen-Hause 1777, 7) zu erziehen. Er wollte die Kinder im Universitätswaisenhaus Vernunft und eigenständiges Denken lehren. Die aufklärerischen Erziehungsansätze der Empfindsamkeit und des Philosophen John Locke (vgl. Locke 1708) sind in diesem Konzept wieder zu finden. Locke sah den Menschen als „ein unbeschriebenes Blatt“ (Lauer 2004, S. 20), der früh mit seiner eigenen Vernunft vertraut gemacht werden solle, um diese zu benutzen. Von den Anstaltslehrern, die manchmal selbst noch Studenten der Theologie waren, wurden sie nicht nur primär geschult, sondern auch Fächer wie Alt-Griechisch, Latein, Französisch sind in Stundenplänen und Prüfungsnotizen belegt. Auch wurde von Miller darum gebeten, ebenfalls Kalligraphie, Ökonomie und Naturwissenschaften zu lehren (Lauer 2004, S. 78-80). Die Waisenkinder hättem durch diese Ausbildung also das Rüstzeug zu einer Gelehrtenlaufbahn bekommen. In der Realität war das jedoch nicht der Fall.
Es setzte sich die schon früher vom vorigen Dekan Leß geäußerte Meinung durch, dass die Ständegesellschaft nicht „vieler nützlicher Glieder beraubt“ (Nachricht des Göttinigischen Waisen-Hauses 1773, S. 3) werden dürfe. Leß fürchtete, dass Handwerkers- und Bauernsöhne sich nach allzuviel humanistischer Bildung zu viel Wissen und Gelehrsamkeit angeeignet hätten: Sie würden sich dann vielleicht nicht wieder in die Gesellschaft einfügen und an ihrer Stelle müssten ihnen gesellschaftlich überlegende Personen „niedere Arbeiten“ (Nachricht des Göttinigischen Waisen-Hauses 1773, S. 3). Die Meinung Leß‘ und das standespolitische Bewusstsein setzten sich auch in der theologischen Fakultät durch. Die Kinder wurden aus Kostengründen im frühen 19. Jahrhundert auf die Pfarrschule der Marienkirche geschickt (Meumann 1997, S. 64). Somit wurden sie schulisch wie andere Gleichaltrige unterer Schichten gebildet.
Veränderungen im 19. Jahrhundert
Es wurde nun Wert darauf gelegt, den Waisenkindern neben der religiösen Prägung, vor allen Dingen handwerkliches Geschick mitzugeben. So bekamen die Mädchen ab 1840 nachmittags Handarbeitsunterricht von Helferinnen des Frauenvereins und die Jungen hatten vor dem Abendessen Sporteinheiten. Der Arbeitsdienst der Waisenkinder betrug nicht mehr wie in der frühen Phase des Hauses sechs bis sieben sondern drei Stunden. Es wurden nur noch Arbeiten im Haus verlangt, aber nicht mehr für die ansässigen Textilbetriebe und die Waisen hatten zwei bis drei Stunden freie Zeit (Meumann 1997, S. 65/66). Trotzdem war das Leben in einem Waisenhaus auch im 19. Jahrhundert durch einen streng geregelten Tagesablauf bestimmt. Es kam auch hier zu Fällen der Mangelernährung und sexuellen Übergriffen. Trotz verbesserten Hygienebedingungen waren Krankheiten an der Tagesordnung (Meumann 1997, S. 70-72). Waisenkinder waren zudem oft Opfer von Diskriminierung und Vorurteilen, so gestaltete sich die Suche nach einer Lehrstelle oft schwierig (Meumann 1997, S. 69).
Die Zukunft der Waisenkinder
Die Jungen und Mädchen des Waisenhauses gingen nach ihrer Entlassung aus dem Waisenhaus meistens der oben beschriebenen, ihrer Herkunft gemäßen Tätigkeit nach. Ein sozialer Aufstieg war für die ehemaligen Heimkinder nicht zu erwarten. In Einzelfällen wurden besonders begabte Jungen des Waisenhauses an ein Lehrerseminar vermittelt und auch finanziell unterstützt. Es ist nur vom Fall Georg Wilhelm Schulze bekannt, der eine Hochschullaufbahn einschlug, promovierte und ein beachteter Theologe und Schriftsteller wurde (Meumann 1997, S. 81-85).
Fazit
Das Waisenhaus war durch die Trägerschaft der Universität zwar eine Besonderheit. Jedoch hatten die Kinder im Vergleich zu anderen Waisenhäusern keine besseren Zukunftschancen. Das Ideal der Erziehung von Mitgliedern der „bürgerlichen Gesellschaft“ wurde zusehends weniger verfolgt und die meisten Kinder kamen nach ihrem Aufenthalt in diesem Haus wieder in ein oft verarmtes Umfeld zurück.
Stand: 31.01.2013
Literatur
Kuhn, Thomas (2003): Religion und neuzeitliche Gesellschaft. Studien zum sozialen und diakonischen Handeln in Pietismus, Aufklärung und Erweckungsbewegung, Tübingen (=Beiträge zur historischen Theologie 122).
Lauer, Gerhard (2004): Rousseaus Kinder. Als die Kinderbücher laufen lernten, in: Nützliches Vergnügen. Kinder- und Jugendbücher der Aufklärungszeit aus dem Bestand der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen und der Vordemann-Sammlung [Katalog zur Ausstellung in der Paulinerkirche Göttingen, vom 5. 12. 2004 – 20. 2. 2005], Göttingen.
Locke, John (1708), Unterricht von Erziehung der Kinder, Leipzig.
Meumann, Markus (1997): Universität und Sozialfürsorge zwischen Aufklärung und Nationalsozialismus. Das Waisenhaus der Theologischen Fakultät in Göttingen 1747–1938, Göttingen.
Quellen
„Die neun und zwanzigst Nachricht von dem Göttingischen Waisen-Hause“, Göttingen 1777.
„Die fünf und zwanzigst Nachricht von dem Göttingischen Waisen-Hause“, Göttingen 1773.
Link
Nachricht von dem Göttingischen Waisenhause im Netz:
http://vd18.de/de-sub-vd18/periodical/titleinfo/21278950 (zuletzt eingesehen am 10.1.2013)