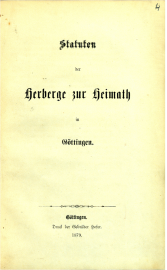von Svenja Dehler
Das heutige Hainberg-Gymnasium in Göttingen blickt auf eine knapp 150-jährige Schulgeschichte zurück, die 1866 mit der Einrichtung einer städtischen höheren Töchterschule begann. Die Gründung der Schule war ein Meilenstein in der öffentlich organisierten Mädchenbildung in Göttingen. Insbesondere für Töchter aus gutbürgerlichen Familien von Professoren und Lehrern war die Schule vorgesehen.
Vorgeschichte
Im Jahr 1806 kam es in Göttingen zur Gründung der ersten öffentlichen Töchterschule, auch Universitäts-Töchterschule genannt. Johann Philipp Trefurt, ein Göttinger Theologe und Superintendent der Stadt, hatte das Anliegen, die Bildung junger, bürgerlicher Mädchen zu fördern. Seine Schule musste ohne staatliche Zuschüsse auskommen. Stattdessen wurden Unterhaltungskosten und Personalausgaben mit Hilfe von Schulgeldern finanziert. Dieses erste organisierte Institut mit ausgebildeten Lehrkräften legte den Grundstein für zukünftige Projekte zur Mädchenbildung. Einige Jahre nach Trefurt eröffnete Friedrich Schwerdfeger 1843 das ebenfalls mit Schulgeldern finanzierte Institut Schwerdfeger. Der Bedarf an Mädchenschulen zu der Zeit war enorm hoch. Innerhalb der ersten Jahre waren es bereits etwa 130 Schülerinnen, die in der Einrichtung Schwerdfeger lernten und die Zahlen stiegen weiter. In den Jahren zwischen 1843 und 1866 gab es noch weitere Privatschulen für Mädchen, die jedoch oftmals nicht den besten Ruf hatten und in denen die Bildung mittelmäßig war (Spieker 1990, S. 13-16, 34-39).
Die städtische höhere Töchterschule
In Göttingen gab es lange Zeit kein geregeltes Mädchenschulwesen. Dies ist verwunderlich aufgrund der vielen, an der Universität angestellten Professoren und Lehrern, die ihren Töchtern eine angemessene Ausbildung bieten wollten. Erst nach langem Nichtstun und Hinnehmen der Situation mobilisierten sich die Eltern und forderten 1865 vom Magistrat die Gründung einer mittleren und höheren Bürger- und Töchterschule. Erst nach einer erneuten Petition Ende des gleichen Jahres wurde eine Kommission berufen, die ein Konzept für eine Mädchenschule ausarbeitete. Erstaunlich schnell gab der Magistrat dem Antrag statt und übernahm die Forderungen unverändert. 1866 konnte schließlich der Unterricht an der Schule, die sich an der Ecke Ritterplan und Jüdenstraße befand, beginnen.
Wie bereits an den anderen Bildungseinrichtungen musste auch an der städtischen höheren Töchterschule Schulgeld bezahlt werden. Allerdings gab es, im Unterschied zu den vorherigen Institutionen, eine finanzielle Förderung seitens des Staates. Die Zahlen entwickelten sich positiv: Bis 1879 gab es acht Klassen mit insgesamt 185 Schülerinnen zwischen sechs und 16 Jahren, acht Lehrer und zwei Hilfskräfte. Innerhalb von 15 Jahren stieg die Zahl der Schülerinnen auf 298 an. Um der Menge an Mädchen gerecht zu werden reichte das Schulgebäude im Ritterplan 8 bald nicht mehr aus. 1880 wurde ein neues Gebäude an der Ecke Nikolaistraße/ Bürgerstraße gebaut (heute Bonifatius-Schule II). Nach Fertigstellung siedelte die gesamte Schulgemeinde in das neue Gebäude über. Der Erfolg der Schule setzte sich weiter fort: 1909 wurde die Schule zum Lyceum erklärt. Auch die Anzahl der Schülerinnen stieg stetig. Der Bedarf an mehr Platz nahm weiter zu und so wurde 1911 im Friedländer Weg 19-23 (heutiges Hainberg-Gymnasium) ein neues Gebäude errichtet. Im Jahr 1927 konnten erstmals 16 Schülerinnen am Hainberg–Gymnasium die Reifeprüfung ablegen. Trotz dieser positiven Entwicklung erhielt die Schule erst 1957 den Status eines Gymnasiums. 1971 kam es zu einer weiteren Veränderung: Zum ersten Mal wurden auch Jungen aufgenommen (Spieker 1990, S. 43-46).
Ein verändertes Familien- und Eheverhältnis
Durch das erweiterte Bildungsangebot für Mädchen kam es zu Wandlungen des Frauenbildes in der Ehe und Familie. Lange Zeit hatten Frauen die Pflichten und Aufgaben einer Mutter und Hausfrau zu erfüllen, die ihrem Ehemann unterstellt war. Dieses Bild veränderte sich mit den vielfältigeren Bildungsmöglichkeiten, die Frauen geboten wurden. Anhand der Göttingerin Dorothea Schlözer, die als erste Frau in Deutschland 1787 die Doktorwürde erhielt, lassen sich die Fortschritte und Veränderungen innerhalb der Familie sowie zwischen den Ehepartnern darstellen. Schlözer konnte nur durch die intensive Förderung ihres Vaters, der gewettet hatte, dass auch Frauen zum „Denken geschaffen“ seien, eine universitäre Ausbildung an der Göttinger Universität genießen. Nach erfolgreichem Abschluss des „Erziehungsexperiments“ durfte Dorothea, aufgrund der damaligen Regeln, nicht an den Feierlichkeiten zur Verleihung des Doktortitels teilnehmen (Koerner 1989, S. 132-135).
Trotz eines Doktortitels in Philosophie und einer umfangreichen, für die Zeit außergewöhnlichen Bildung, hielt Dorothea Schlözer an dem traditionellen Ehebild fest. Es stand außer Frage, dass sie heiraten und eine Familie gründen würde. Allerdings, und das ist der entscheidende Punkt, sah sie sich nicht in der Position einer Hausfrau und eine dem Mann unterstellten Ehefrau gebunden. Vielmehr wollte sie ihrem Ehemann eine „Gefährtin und Gehilfin“ sein, die zum Einkommenserwerb der Familie beitrug.
Auch wenn Dorothea Schlözer lange Zeit vor der Gründung der städtischen höheren Töchterschule gelebt und gewirkt hat, waren ihre Ansichten zum Familien- und Eheverständnis neu und herausragend für ihre Zeit. Ihr Bild von der Beziehung zwischen Mann und Frau innerhalb der Familie war revolutionär (Koerner 1989, S. 132-135). Nur wenige Jahre danach etablierte sich dieses Bild in vielen Familien, in denen Mädchen und Frauen die neuen Möglichkeiten einer schulischen Ausbildung genießen konnten (Habermas 2000, S. 232-242). Im späten 19. Jahrhundert schließlich übernahmen bürgerliche Frauen zunehmend Aufgaben in der öffentlichen Wohlfahrt (siehe Frauenverein) und ergriffen Lehr- und Pflegeberufe (siehe Diakonie).
Literaturverzeichnis:
Spieker, Ira (1990): Bürgerliche Mädchen im 19. Jahrhundert, Erziehung und Bildung in Göttingen 1806-1866, Göttingen.
Habermas, Rebekka (2000): Frauen und Männer des Bürgertums. Eine Familiengeschichte (1750-1850), Göttingen.
Koerner, Marianne (1989): Auf die Spur gekommen. Frauengeschichte in Göttingen, Weigang/ Neustadt.