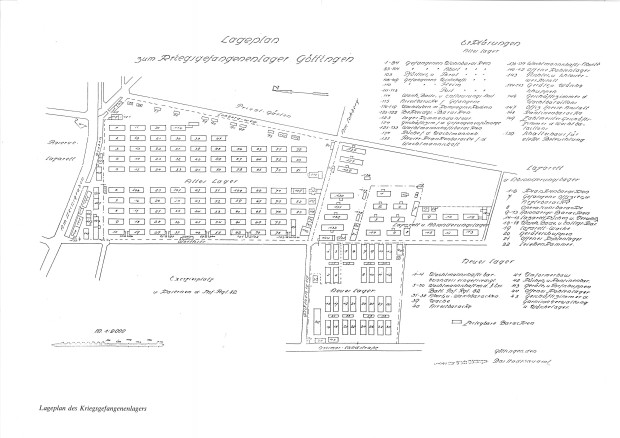von Sebastian Wolfram Hennies
Die Maschinenwerkstatt bzw. Ausbesserungwerk der Eisenbahn nahm seit der Gründung 1855 im Leben vieler Göttinger eine wichtige Rolle ein. Das noch heute vorhandene und 1917-1920 erbaute Hauptgebäude, die Lokrichthalle, ist seit der öffentlichen Debatte um die Nachnutzung als „Lokhalle“ bekannt. Neben der Universität war die Eisenbahn bis 1976 einer der stabilsten und wichtigsten Arbeitgeber.
Vorbemerkungen
Es beschäftigte überwiegend männliche Arbeiter. Nur zu Kriegszeiten, vor allem im zweiten Weltkrieg, kamen Frauen in die Lokhalle und halfen den Mangel an Arbeitern auszugleichen. Ihre Rolle soll auf keinen Fall gering geschätzt werden, jedoch ist sie für das 19. und beginnende 20. Jahrhundert nicht von größerer Bedeutung und damit auch nicht für diesen Text, da dieser die Zeit von 1855 – ungefähr Anfang des 20. Jahrhunderts behandelt. Ich verzichte daher auf ein durchgehendes gendering der Begriffe.
Die Quellenlage zur Lokhalle ist insgesamt dünn. Zwar gibt es einige moderne Werke zur Lokhalle, jedoch gehen diese nur bedingt auf die Zeit vor 1900 ein und beleuchten zudem die Arbeiterkultur wenig bzw. gar nicht. Günther Siedbürger macht auf die Quellenlage aufmerksam und verweist unter anderem auf eine Notiz, die er während der Archivrecherche fand: „Akte NStA (Niedersächsisches Staatshauptarchiv) Hann 133 acc. 30/82, Nr. 6 (…) „Göttingen. Werkstätten. Vernichtet im Jahre 1972“. Während der Arbeit an seinem Buch nahm laut eigenen Aussagen die Archivarbeit den größten Teil ein. So konnte er viele Fakten sammeln und in seinem Werk darstellen. Auf seinem Buch und den darin präsentierten Ergebnisse basiert dieser Text.
Reichsbahnausbesserungswerke
Mit der Entstehung der Eisenbahn in Deutschland im Jahre 1835 wurden zur Ausbesserung und Instandhaltung der Lokomotiven und Wagen kleine bahneigene Werkstätten als Reparaturstellen eingerichtet. Mit der Erweiterung des Eisenbahnnetzes und der damit verbundenen notwendigen Vergrößerung des Fahrzeugparkes sind die Eisenbahnwerkstätten für eine planmäßige Erhaltungswirtschaft ausgebaut worden. Sie nahmen in der Folgezeit immer mehr den Charakter von Reparaturwerkstätten mit einer bestimmten Organisation und Arbeitsteilung an. Reichsbahnausbesserungswerke waren ab den 1920er Jahren technische Großbetriebe, deren Aufgabe in der wirtschaftlichen Unterhaltung der Betriebsmittel der Deutschen Reichsbahn bestand. Die Geschichte aller Werke zeigt, dass die Städte und Territorien nichts unversucht ließen, ein solches Werk in ihren Mauern zu besitzen. Die gesicherte Stellung der Beschäftigten bei der Deutschen Reichsbahn wirkte sich sowohl kulturell als auch wirtschaftlich auf die Stadt, die Geschäftswelt und die Schulen aus.

Lokhalle heute von Nordost; Quelle: Wikimedia Commons, GNU Free Documentation License
Die Lokhalle in Göttingen
Wahrscheinlich 1855 wurde die Göttinger Lokhalle eröffnet. Einen genauen Beleg gibt es dafür nicht. Sie gehörte damals und bis 1914 zum größten (Staats)Unternehmen der Welt: Der preußisch-hessischen Staatseisenbahn. Bei ihrer Gründung hieß sie „Maschinenwerkstatt“ und war verhältnismäßig klein. Sie bestand bei ihrer Gründung 1855 aus Lokomotivhalle, Schmiede, Tischlerei, Wagenwerkstatt, Radsatzwerkstatt, zwei Schiebebühnen, Verwaltungsgebäude, Kesselhaus mit Dampfmaschine, mit welcher über Transmissionsriemen die Maschinen in der mechanischen Fertigung angetrieben wurden. Später wurde sich in „Ausbesserungswerkstatt“ umbenannt. Es kamen bis 1892 hinzu: Stofflager, Werkzeugmachere, Schlosserei, eine zweite Lokhalle, Tenderwerkstatt, Gelbgießerei, Kupferschmiede, Klempnerei und eine neue Halle für die Wagenausbesserung. Erst mit dem Ende des 20. Jahrhundert kam der Begriff „Lokhalle“ in Berührung mit dem Gebäude, welches in der heutigen Bahnhofsallee in Göttingen anzufinden ist. Die Halle „Lokhalle“, die heute noch zu sehen ist, ist ein großer Teil des Gesamten Komplexes und wurde 1917 erbaut. Entscheidend für diese Position außerhalb der Stadt waren im Wesentlichen drei Faktoren. Einerseits stand in unmittelbarer Nähe der Bahnhof, der 1855 eröffnet wurde und wohl auch den ausschlaggebendsten Faktor darstellt. Nicht unerheblich war auch die Größe des Grundstücks, das man nur außerhalb der Innenstadt finden konnte. Andererseits gab es auch die preußische Bestimmung, dass sich Ausbesserungswerke abgelegen von Wohngebieten und viel befahrenen Straßen befinden mussten. Der enorme Geräuschpegel, der in den Hallen vorherrschte, wäre für die Umgebung zur Dauerbelastung geworden.
Mehr Loks, mehr Arbeiter. Die Entwicklung.
In der Lokhalle wurden vor allem Reparatur- und Wartungsarbeiten verrichtet. Lediglich die Teile für die Reparatur wurden in der Kesselschmiede hergestellt. Schon im 19. Jahrhundert gab es verbindliche Vorschriften, die bei Lokomotiven alle 6 Jahre eine Hauptuntersuchung und alle 3 Jahre eine Zwischenuntersuchung vorsahen. Bei Unfällen oder Ähnlichem wurden die Loks sofort repariert. Aber nicht nur Loks wurden repariert und gewartet, auch Weichen und Gleiswagen wurden unter die Lupe genommen. Göttingen war auf Grund seiner geografisch-politischen Lage ein wichtiger Anlaufpunkt für die Eisenbahn. König Ernst August wollte keine Bahntrasse durch Hessen und so führte er die Hannoversche Südbahn von Göttingen die steile Strecke über Dransfeld nach Hannoversch Münden. Dazu mussten stärkere Loks vor die Wagons gespannt werden. Die ausgespannten Loks wurden so in Göttingen gleich gewartet. Die Göttinger Lokhallen-Arbeiter hatten damit reichlich zu tun. Von 1847 bis 1914 stieg die Zahl der Lokomotiven der Eisenbahndirektion Hannover von 42 auf ca. 1500 Loks an. Gleichzeitig wuchsen auch die Belegschaft und die Anforderungen. Wahrscheinlich sind diese Entwicklungen dem erhöhten Transportaufkommen im Zuge der steigenden Zahl an Überseeexporten, die über Bremerhaven abgewickelt wurden, geschuldet. Zahlen zum Beschäftigtenstand finden sich bis 1868. Vereinzelt auch noch in den 1890ziger Jahren. Zu beobachten ist jedoch zwischen 1860 und 1870, dass sich die Belegschaftszahl fast verdreifachte. 1855 war man noch mit ungefähr 60 Mitarbeitern gestartet. 1870 knackte man schon die 300-Mitarbeiter-Marke und kam 1900 bei 500 an.
Arbeitssituation. Kontrolle, Arbeitszeit und Lohn.
Gearbeitet wurde im Gedingverfahren, welches eine Form der Akkordarbeit war. Dabei wurde der Arbeitsprozess in Abschnitte unterteilt und auf Kolonnen aufgeteilt. Auch die maximal benötigte Zeit für die Aufgabe und die Anzahl der zu schaffenden Aufgaben wurde von einem unteren Beamten eingeteilt. Für die Wirtschafter bedeutete die Gedingarbeit eine Ersparnis an den Löhnen und höhere Produktivität. Für die Arbeiter, die in einer 20 Personen umfassenden Kolonne arbeiteten, brachte dies enormen Zeitdruck, geringere Grundlöhne und schlechtere Arbeitsbedingungen. Dabei war ihr Arbeitsalltag geprägt von Lärm und Schmutz. Arbeitssicherheit gab es zu damaliger Zeit nicht. Viele Arbeiten, wie das Vernieten des Heizkessels, gingen mit einer immensen akustischen Belastung einher. Die unmittelbar beteiligten Arbeiter büßten so in kürzester Zeit den Großteil ihrer Hörfähigkeit ein. Auch die geringe Beleuchtung der Halle stellte ein großes Risiko dar. Zwar waren die Hallen überdacht, dies bot Witterungsschutz, ließ aber kaum Licht ins Innere. So gab es viele offene Gasglühlampen. Kleinere Öllampen spendeten etwas Licht bei Arbeiten unter den Loks. Nicht zuletzt durch die Gedingarbeit und weitere Umstände (Lärm und Licht) waren die Arbeitsbedingungen schlecht. Auch die Ausstattung war anscheinend nicht immer dem damaligen Standard entsprechend. So beschrieb ein Arbeiter 1904 den Prozess des Hochwindens einer Lok: „Das Hochwinden der Lok erfolgte durch 4 – 6 Windeblöcke mit Handkurbeln, von 16-24 Personen, in 1 ½ Stunden (…) Für Reparatur von heißgelaufenen Achslagern waren in jeder Abteilung 2 Gleise mit Senkkanal verfügbar. Das Heben und Senken der Achsen erfolgte in der neuen Bude hydraulisch, in der alten Bude mit Handkurbelwerk, die 1910 durch hydraulische ersetzt wurde.“ (Siedbürger 1995, S. 23) Tatsächlich dauerte wohl das Hochwinden wesentlich länger als hier beschrieben: „Ein Arbeiter erzählte, ihm habe sich als Kind der Satz seines von der Arbeit im Werk heimkommenden Vaters eingeprägt: ‚Heute haben wir wieder eine Lok hochgezogen!’“. (Siedbürger 1995, S. 23)
Gearbeitet wurde von Montag bis Sonnabend. Dabei musste die Belegschaft der Göttinger Lokhalle 1904 10 Stunden/Tag arbeiten. Diese Stunden waren an die Jahreszeiten angepasst. Im Sommer: 6:30 – 18:00 Uhr und im Winter: 7:00 – 18:30 Uhr. Pausen wurden stets von 12 – 13 Uhr genommen. Nicht inbegriffen sind Überstunden, die sich wohl im Bereich zwischen einer und zwei Stunden aufhielten und nötig waren, um wenigstens etwas zum geringen Grundlohn hinzu zu verdienen. Kontrolliert wurde dies von einem Pförtner. Die Entlohnung für diese vielen Stunden war im Vergleich zur Privatwirtschaft unterdurchschnittlich. „Lohnenswert“ machte diese Arbeit nur die Verteilung des Lohns auf die Länge des Angestelltenverhältnisses bzw. das Alter der Arbeiter. Steigerte sich der Lohn in der Privatwirtschaft vom Anstellungsbeginn bis etwa zum 40. Lebensjahr und sank bis zur Rente wieder rapide ab, so stieg die Bezahlung der Arbeiter in der Lokhalle von ihrem 12. – 20. Beschäftigungsjahr stetig an, und behielt dann das Niveau des 20. Beschäftigungsjahres bis zur Rente. Zudem durften die Lokhallenbeschäftigten nur bei schweren Verstößen gekündigt werden, sodass man davon ausgehen kann, dass die Anstellung verhältnismäßig sicher war und auch sicherer entlohnt wurde. Arbeiter in der Privatwirtschaft hatten meist ein wesentlich lockeres Arbeitsverhältnis und wurden durch die Lohnpolitik überwiegend mit fortgeschrittenem Alter der Armut überlassen. Trotzdem war ein Lokhallen-Arbeiter-Leben mit einer vierköpfigen Familie ohne einen zweiten Verdienst nicht möglich. Zu schlecht war trotz der stabilen Arbeitssituation das Auskommen der Arbeiter und damit auch ihrer Familien. So darf man nicht vergessen, dass im Kaiserreich durchschnittlich 60 % des Lohnes auf Nahrung entfiel und 20 – 30 % auf die Miete. Es war wenig finanzieller Spielraum da, um Ersparnisse anzulegen oder seine Wohn- und Lebenssituation entscheidend zum Besseren zu ändern. Die Arbeiterbewegung allerdings auch in Göttingen Gelegenheit zur Weiterbildung und zur klassenbewußten Geselligkeit (Volksheim)
Fazit. Unsicher, hart und kontrolliert.
Zusammenfassend kann man sagen: Das Leben eines Lokhallen-Arbeiters war geprägt von geringer Entlohnung bei gleichzeitigem hohen Arbeitspensum. Diese Arbeit war meist sehr hart und nicht sicher. Dabei arbeitete er in einem immer größer werdenden Industriekomplex, der immer mehr Arbeiter anstellte. Als positiv muss dabei die überdurchschnittlich sichere Anstellung dieser Arbeiter erwähnt werden. Die Lokhalle produzierte nicht wie Privatwirtschaft verarmte Menschen, trug dabei aber auch nicht sonderlich zur Verbesserung der Situation ihrer Arbeiter bei. Sozial nachverträglich war jedoch die Rente, die verhinderte, dass sich die schwierige ökonomische Situationen der ehemaligen Arbeiter weiter verschlechterten. Gleichzeitig setzte die Lokhalle ihre Arbeiter aber auch unter massiven Druck. Sei es die Gedingarbeit, die faktische Verpflichtung zu Überstunden oder auch der Einsatz von Kontrollpersonal, wie die Pförtner und unteren Beamten, die die Gedingarbeit kontrollierten und festlegten.
Als das Werk 1976 endgültig geschlossen wurde, konnte zunächst keine Nachnutzung gefunden werden und der Komplex blieb Industrieruine. In den 1990er Jahren wurde die Haupthalle umgebaut. Er entstand ein Kongresszentrum mit Veranstaltungshalle, Restaurants und Multiplexkino (Burmeister/Heinzel 2001).
zuletzt bearbeitet am 31. Januar 2013.
Literatur:
Burmeister, Karl/ Mathias Heinzel (2001), Die Göttinger Lokhalle im Otto-Hahn-Zentrum. Von der Industrie-Ruine zur Mehrzweckhalle. 120 Jahre Göttinger Eisenbanhgeschichte, Göttingen.
Siedbürger, Günther (1995): „Die Lokhalle und ihre Eisenbahner. Werksgeschichte und Arbeiterkultur in Göttingen 1855 – 1915, Göttingen.